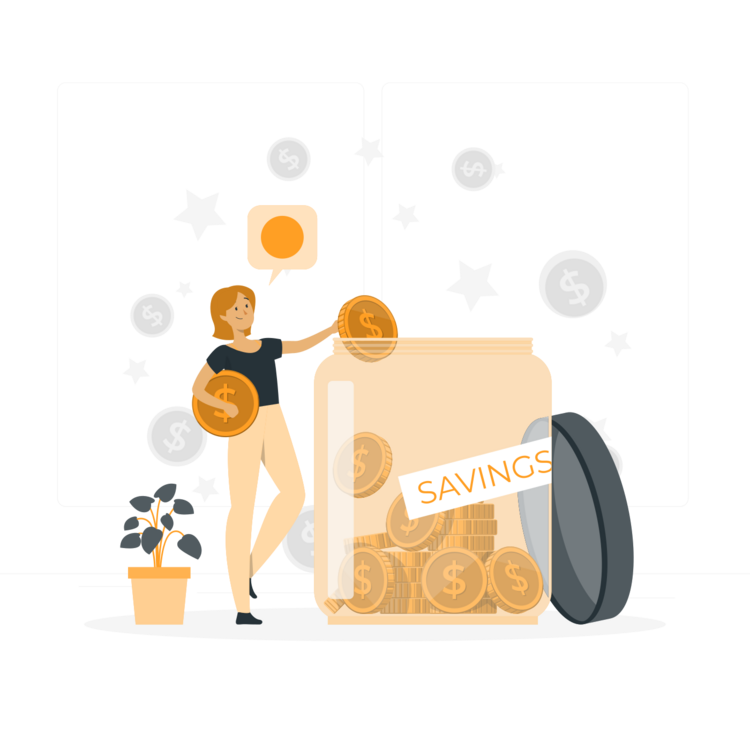Florian Solich - Steuerberater, Master of Arts (Taxation), M.A.
Leitsatz
Gegen die Höhe des Gewinnzuschlags nach § 6b Abs. 7 EStG bestehen auch bei einem strukturellen Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
Tenor
Die Revision der Klägerinnen gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 18.09.2023, 10 K 1459/22 wird als unbegründet zurückgewiesen.
(…)
Tatbestand
Die Klägerin und Revisionsklägerin (zu 1.) betreibt seit dem 01.07.2020 einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in der Rechtsform einer GbR. Die Gesellschafter waren eine Erbengemeinschaft, bestehend aus D (Klägerin zu 2.), dessen Tochter C sowie dem Ehemann von D.
Die GbR ermittelte den Gewinn im Rahmen eines abweichenden Wirtschaftsjahres (01.07. – 30.06.).
Die Erbengemeinschaft hatte i. R. d. Gesellschaftsgründung ihren land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in eine GbR eingebracht. Die verpachteten land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke wurden im Sonderbetriebsvermögen der GbR erfasst.
Ebenfalls im Sonderbetriebsvermögen befand sich die Fortführung einer Rücklage nach § 6b EStG, die aufgrund einer Grundstücksveräußerung im Jahr 2018/2019 gebildet wurde.
In 2020/2021 löste die GbR die Rücklage nach § 6b EStG gewinnerhöhend auf. Da in diesem Zusammenhang kein Abzug von Anschaffungs- oder Herstellungskosten von einem Reinvestitionsobjekt vorgenommen wurde, wurde der Sondergewinn der Erbengemeinschaft um den Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG für zwei volle Jahre erhöht.
Im Herbst 2021 verstarb C. C wurde durch D (Klägerin zu 2.) beerbt.
Das Finanzamt (Beklagte und Revisionsbeklagte) erließ erklärungsgemäß am 25.02.2022 einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für 2020. Im Sonderbetriebsgewinn der Erbengemeinschaft waren der hälftige Betrag aus der Auflösung der Rücklage und der hälftige Gewinnzuschlag i. S. d. § 6b Abs. 7 EStG enthalten.
Die hiergegen – nach erfolglosem Einspruchsverfahren – erhobene Klage, mit der sich die Kläger nur gegen den Ansatz des (außerbilanziellen) Gewinnzuschlags nach § 6b Abs. 7 EStG wenden, wies das Finanzgericht ab. Grund der Klage waren verfassungsrechtliche Bedenken aufgrund der Höhe des Gewinnzuschlags.
Während des Klageverfahrens erließ das Finanzamt durch die eingetretene Rechtsnachfolge von D am 06.07.2023 einen neuen Steuerbescheid, in dem anstelle der Erbengemeinschaft die Klägerin zu 2. als Feststellungsbeteiligte aufgeführt wurde.
Mit der Revision rügen die Klägerinnen die Verletzung materiellen Rechts. Der Gewinnzuschlag i. H. v. 6 % des aufgelösten Rücklagebetrags für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage bestand, sei verfassungswidrig. Die typisierte Verzinsung stehe nicht mehr im Einklang mit dem derzeitigen Niedrigzinsniveau.
Sie beantragten, das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 18.09.2023, 10 K 1459/22 sowie die Einspruchsentscheidung vom 22.06.2022 aufzuheben und die Bescheide für 2020 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom 25.02.2022 und vom 06.07.2023 dahingehend zu ändern, dass der außerbilanziell berücksichtigte Gewinnzuschlag unterbleibt.
Das Finanzamt beantragt die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
Die Revision der Klägerinnen ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO).
Das Finanzgericht hat entschieden, dass der Gewinn für 2020/2021 nach § 6b Abs. 7 EStG für jedes Jahr, in dem die Rücklage bestand, um einen Gewinnzuschlag i. H. v. 6 % des aufgelösten Rücklagenbetrags zu erhöhen ist.
In diesem Urteilsfall hat das Finanzamt den Sonderbetriebsgewinn der Erbengemeinschaft zu Recht nach § 6b Abs. 7 EStG erhöht und diesen Gewinn hälftig im Streitjahr 2020 berücksichtigt (§ 4a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EStG).
Der Ansatz des Gewinnzuschlags nach § 6b Abs. 7 EStG ist verfassungsrechtlich weder dem Grund noch der Höhe nach zu beanstanden. Der Gewinnzuschlag verstößt auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG).
Der Senat hatte bereits erhebliche Zweifel, ob der Anwendungsbereich des Gleichheitsgrundsatzes überhaupt tangiert wird.
Mit § 6b Abs. 7 EStG sieht der Gesetzgeber einen Gewinnzuschlag nur dann vor, falls die Rücklage aufgelöst wird, ohne dass sie auf ein Reinvestitionsgut übertragen wurde. Hingegen wird der Gewinn nicht um einen typisierten Zuschlag erhöht, falls die Rücklage innerhalb des Investitionszeitraums auf ein neues Wirtschaftsgut übertragen oder auf die Bildung einer gewinnmindernden Rücklage verzichtet wurde. Ob der Gewinn aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts im Jahr der Veräußerung oder im Anwendungsbereich des § 6b EStG zu einem späteren Zeitpunkt besteuert wird, hängt indes vom Wahlrecht des Steuerpflichtigen ab, ob und in welcher Höhe eine Rücklage gebildet wird, ob diese auf ein Reinvestitionsgut übertragen wird und zu welchem Zeitpunkt die Rücklage freiwillig oder zwangsweise aufgelöst wird.
Angesichts dieser Wahlrechte sieht der Senat keine Eröffnung des Anwendungsbereichs des Art. 3 GG.
Der BFH sieht die Auferlegung eines Gewinnzuschlags und dessen Zielrichtung als sachlich gerechtfertigt an.
§ 6b EStG ist eine Lenkungs- und Sozialwerknorm mit Subventionscharakter, die im Subventionsbericht der Bundesregierung ausgewiesen ist (29. Subventionsbericht vom 06.09.2023, BT-Drucks. 29/8300, S. 102, 486).
Diese Subventionserleichterung hat der Gesetzgeber mit einem Gewinnzuschlag durch § 6b Abs. 7 EStG belegt. Damit will er den durch Rücklagenbildung im Laufe des Reinvestitionszeitraums entstandene (Steuerstundungs)Vorteil für den Steuerpflichtigen durch Erhöhung des Gewinns im Jahr der Auflösung der Rücklage rückgängig machen, wenn die begünstigte Reinvestition nicht vorgenommen wird.
Aus Sicht des Gesetzgebers besteht für solche Vorgänge keine Notwendigkeit, dem Steuerpflichtigen den durch Rücklagenbildung eingetretenen Zinsvorteil zu gewähren (BT-Drucks. 9/842, S. 66). Zugleich dient der Gewinnzuschlag der Vermeidung einer missbräuchlichen Inanspruchnahme des Rücklagenwahlrechts und sichert damit den subventiven Zweck der Reinvestitionsbegünstigung (BFH-Urteil vom 09.07.2019, X R 7/17, BFHE 265, 346, BStBl. II 2020, S. 635, Rz. 37).
Bezüglich der Höhe der Verzinsung schließt der BFH eine Gesetzeswidrigkeit aus. Dies gilt auch bei einem strukturellen Niedrigzinsniveau (zuletzt BFH vom 29.04.2020, XI R 39/18, BFHE 269, 38, BStBl. II 2021, S. 517, Rz. 30).
Der BFH stellt klar, dass der Gesetzgeber im Hinblick auf den dargelegten Lenkungszweck von Reinvestitionsbegünstigung und Gewinnzuschlag nicht gehalten ist, sich bei der Bemessung des Gewinnzuschlags ausschließlich an dem vom Steuerpflichtigen zu erzielenden Stundungsvorteil zu orientieren. Der Gesetzgeber ist deshalb auch nicht verpflichtet, die Höhe des Gewinnzuschlags fremdkapitalmarktkonform und realitätsgerecht auszugestalten. Vielmehr steht der (steuerliche) Lenkungszweck im Vordergrund (FG Münster, Urteil vom 17.11.2020, 2 K 7511/97 E).
Es ist auch nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber die Höhe des Gewinnzuschlags nicht mit einem Zinssatz auf die Steuer bemisst, die ohne Rücklagenbildung im Veräußerungsjahr beim Steuerpflichtigen angefallen wäre, sondern aus Vereinfachungsgründen pauschal für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage bestanden hatte, angesetzt wird. Durch den pauschalierten Ansatz wird die (im Einzelfall) schwierige Ermittlung des konkreten wirtschaftlichen Vorteils unter Beachtung von Zinseszinseffekten und dem jeweiligen Steuersatz vermieden. Der Gesetzgeber macht von seiner uneingeschränkten Typisierungsbefugnis rechtmäßig gebrauch (zuletzt BVerfG vom 06.07.2010, 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, 318, Rz. 38).
Dem steht nicht entgegen, dass ausweislich der Gesetzesbegründung durch Erhöhung des Gewinns der gewährte Zinsvorteil wieder ausgeglichen werden soll (BT-Drucks. 9/842, S. 66). Der Gesetzgeber hat den Gewinnzuschlag rechtlich nicht als gesetzliche Zinssatztypisierung und damit auch nicht als steuerliche Nebenleistung (§ 3 Abs. 4 AO) definiert. Vielmehr wird der Stundungsvorteil aus dem zweckwidrig nicht reinvestierten Veräußerungsgewinn pauschal nach dem in der Rücklage eingestellten Eigenkapital bestimmt und erfasst damit denjenigen Gewinn, der auf die Kapitalnutzung entfällt (BFH-Urteil vom 15.03.2020, I R 17/99, BFHE 192, 353, BStBl. II 2001, S. 251).
Der BFH verneint in seinem Urteilsspruch auch, dass die Pauschalmethode des § 6b Abs. 7 EStG zu keiner übermäßigen steuerlichen (Mehr)Belastung führt.
Des Weiteren eröffnet die Regelung des § 6b EStG steuerbegünstige Wahlrechte für den Steuerpflichtigen. So kann die Rücklage wahlweise in einem Jahr mit einem niedrigen (Grenz-)Steuersatz aufgelöst werden und damit bis zu einer völligen Steuerbefreiung führen.
Auch lässt sich der Veräußerungsgewinn über die Bildung einer Rücklage in einen tarifbegünstigen oder steuerfreien Gewinn umwandeln, wenn die Rücklage bspw. bei einer Betriebsaufgabe oder Betriebsveräußerung aufgelöst wird (BFH-Urteil vom 20.03.2025, VI R 20/23, Rz. 30 mit Verw. auf Kanzler, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht 2024, S. 2765).
Fazit
Der Gewinnzuschlag für nicht getätigte Reinvestitionen ist verfassungsrechtlich hinreichend sachlich gerechtfertigt und nicht zu beanstanden. Es ist dem Gesetzgeber nicht zu verwehren seinem Subventionsangebot Nachdruck zu verleihen, (steuerrechtliche) Mitnahmeeffekte zu vermeiden und Regeln zu schaffen, die eine Verwirklichung zur gesetzgeberisch gewollten Reinvestition in angemessener Weise sicherzustellen.
Der BFH hält in dieser Urteilsentscheidung an seiner bisherigen Rechtsprechung fest (vgl. BFH-Urteil vom 29.04.2020, XI R 39/18, BFHE 269, 34, BStBl. II 2021, S. 517, Rz. 18, m. w. N.).
Quelle:
- BFH-Urteil vom 20.03.2025, VI R 20/23